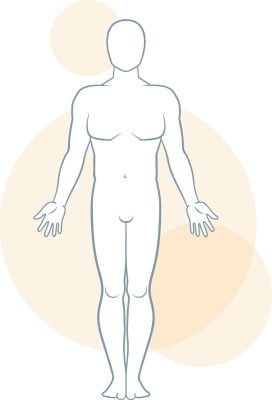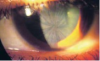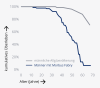




Video
Nephrologische Symptome: Beteiligung der Nieren bei Morbus Fabry

Video
Kardiologische Symptome: Beteiligung des Herzens bei Morbus Fabry

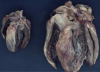


Video
Neurologische Symptome: Beteiligung des Nervensystems bei Morbus Fabry
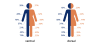
Video
Gastrointestinale Beschwerden: Beteiligung des Magen-Darm-Traktes bei Morbus Fabry

Dermatologische Symptome: Beteiligung der Haut bei Morbus Fabry

Ophthalmologische Symptome: Beteiligung der Augen bei Morbus Fabry
Auditorische und vestibuläre Symptome: Beteiligung des Gehörs und des Innenohrs bei Morbus Fabry
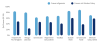
Quellen